

Text: Andreas Günther; Fotos: Photocase, Shutterstock
Dieser Artikel ist ursprünglich erschienen in 0dB - Das Magazin der Leidenschaft N°3
Warum macht uns Moll traurig, warum jubilieren wir in Dur? Weil ein alter Grieche die Planeten auf ihren Bahnen belauscht hat. Bach und die Beatles folgten seinen mathematischen Spielregeln.
Pythagoras. Bei diesem Namen erschaudern noch heute viele Mathematikschüler. Der große griechische Philosoph hat nicht nur die heutige Mathematik begründet, er ist auch der Schöpfer unserer Musikkultur. Pythagoras lebte um 500 vor Christus, hatte einige Jahre in Ägypten verbracht und die dortige Zahlenmystik studiert. Nach seiner Ansicht werden Menschen von Göttern, Ziffern und Proportionen beherrscht. Die höchste Form der geistigen Annäherung an die Götter erlangen die Sterblichen - durch Musik. Die das komplette Universum erfasst.
Eine wunderbare Vorstellung: Die Planeten kreisen durch das All und produzieren dabei Töne. Unhörbar für die Menschen, reinste Göttermusik - die von den und für die Sterblichen aber übersetzt werden kann. Zwei Begriffe aus dieser Philosophie haben es bis in unseren heutigen Sprachgebrauch geschafft: Die einzelnen Töne der "Sphärenmusik" ergeben einen zauberhaften Zusammenklang, die "Symphonia". Das Weltbild der alten Griechen hatte aus heutiger Sicht auch irreführende Momente. Man mag noch verstehen, dass die Schule um Pythagoras annahm, dass schnelle Planeten laute Geräusche erzeugen und die Tonhöhe durch die Nähe oder eben die Entfernung zum Mittelpunkt des Universums entsteht. Dass jedoch dieses Zentrum des Alls ausgerechnet der kleine Planet Erde sein soll, ringt uns heute eher ein Lächeln ab. Was nichts an der Faszination der Sphärenmusik ändert.
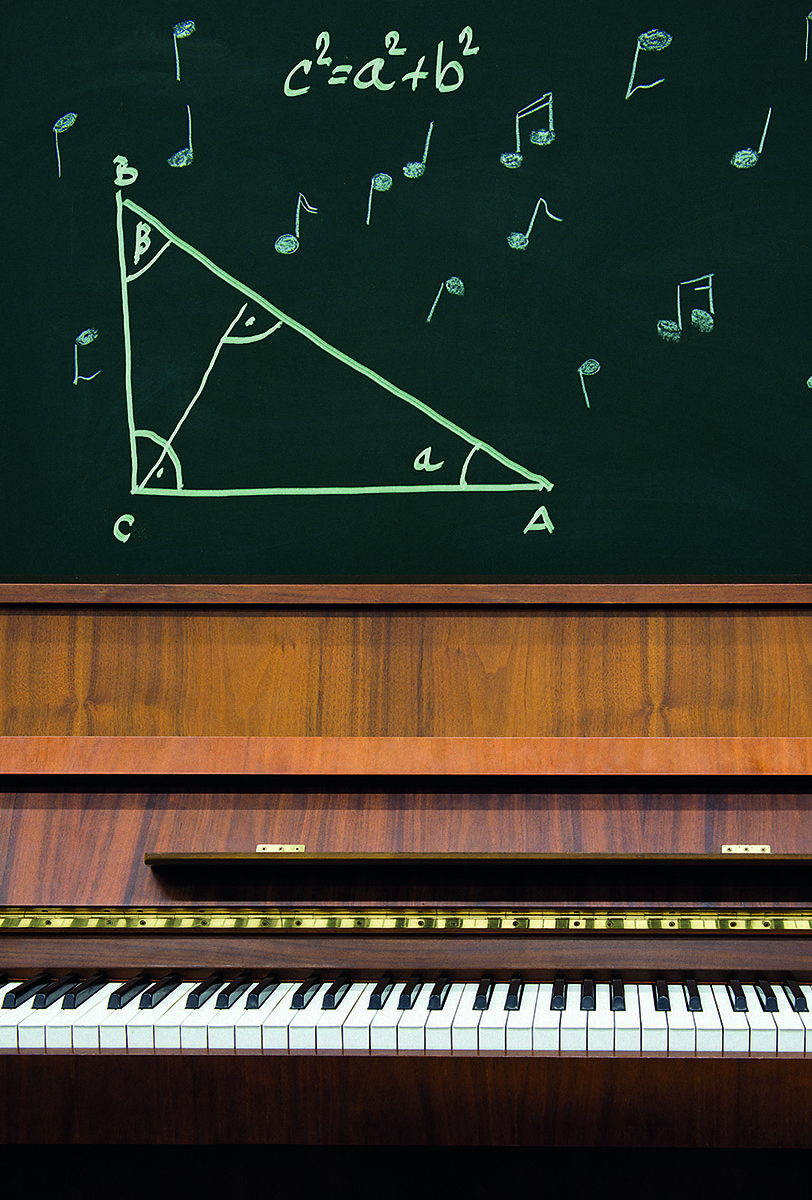
Selbst der aufgeklärte, wissende Goethe hielt noch 2000 Jahre später an dieser poetischen Vorstellung fest. Seinen berühmten "Faust" eröffnet er mit einem "Prolog im Himmel" und lässt den Erzengel Raphael verkünden: "Die Sonne tönt nach alter Weise / in Brudersphären Wettgesang, / und ihre vorgeschriebene Reise / vollendet sie mit Donnergang." Pythagoras versuchte genau dieses Unmögliche: Die Sonne in Töne zu fassen, eine Übersetzung des Sternenklangs in tönende Mathematik. Dazu baute er sich das Instrument der Instrumente: einen "Monochord". Das "Instrument" mit der einen Saite wurde nach mathematischen Vorgaben genutzt. Vielmehr geteilt. Das System des Pythagoras funktioniert noch heute. Wer eine Saite exakt in der Mitte teilt, erhält die Oktave des Basistons. Also ein Schwingungsverhältnis von 1:2. Pythagoras unterteilte die Saite in insgesamt zwölf Einheiten - die unser heutiges Tonsystem der zwölf Halbtöne darstellen. Acht definierte Töne auf diesem System ergeben - hintereinander gespielt - eine Tonleiter. Drei definierte Töne - zur gleichen Zeit angeschlagen - einen Dreiklang, der die Harmonie bestimmt. Charakteristisch in diesem Dreiklang ist für unsere Ohren der mittlere Ton: die Terz. Eine "große Terz" wird als hell, weit und offen definiert - das Tongeschlecht "Dur". Eine "kleine Terz" klingt hingegen für uns traurig, dramatisch - das Tongeschlecht "Moll". Schon der Sprachstamm plaudert die emotionale Bedeutung aus: Dur stammt vom lateinischen "durus", "hart" - Moll dagegen von "mollis", "weich".

Begriffe, mit denen ihr Erfinder Pythagoras nichts hätte anfangen können. Denn die westliche Musikwirklichkeit hat etliche weitere Tonarten schlicht mit den Jahrhunderten abgeschafft. Heute spielt kaum jemand "lydisch", "phrygisch" oder "dorisch". In kritischem Sinn ist unser Tonsystem verarmt - die zwei Pole Dur und Moll bestimmen eine Welt, die schon zu Platons Zeiten reicher, aber auch abgründiger war. Für Platon war Musik nicht nur schön, sondern auch gefährlich. Der Philosoph forderte staatliche Aufsicht. Da Musik "wildes Entzücken" wecken könne, müsse die Demokratie gegen rauschhafte Aufstände geschützt werden. Gleiche Aufschreie erhoben die Moralapostel Jahre später auch bei Berlioz, Wagner, Elvis und den Beatles.
Besonders verächtlich war den edlen Griechen die "phrygische Mode". Hier tobte orgiastische Musik mit Flöte, Klapper und Handpauke - vor allem in den unteren sozialen Bevölkerungsgruppen. Die Popmusik der Antike. Wäre es nach Platon gegangen, hätten gebildete Griechen nur das Dorische zu Ohren bekommen. Diese Tonart machte den Menschen "stärker gegen das Schicksal", konnte inneres Gleichgewicht erzeugen, dorisch galt als ritterlich und mannhaft. Als eher feminin wurde dagegen das Lydische angesehen: die Tonart des Zarten und Intimen. Aristoteles forderte sie als Standard zur Erziehung der Jugend. In seiner "Politeia" widerspricht Platon: "... wir können Klagen und Jammer nicht brauchen, weshalb die lydischen Tonarten beseitigt werden müssen; denn sie sind unbrauchbar für Frauen, die wacker sein sollen, geschweige denn für Männer." Desgleichen seien die "weichlichen und für Trinkgelage" geeigneten Tonarten - darunter auch die ionische Nebentonart - verachtenswert. Im Rückblick eine schwer verständliche Philosophie - steht doch das Lydische am nächsten zum modernen Dur, das für uns Schwung, Kraft und Freude verkündet.
Hören ist kulturelle Versklavung. Von der Vielfalt der antiken Tonarten sind wir über 2000 Jahre entfernt. Der heutige Mensch ist konditioniert auf Dur und Moll, zumindest im westlichen Kulturraum. In diesem System sind wir zu Hause, aber auch gefangen. Die Armut ist hausgemacht. Noch im Mittelalter stimmten Mönche in bis zu acht unterschiedlichen Modi plus Nebenmodi an. Gott wurde gelobt in dorisch, phrygisch, lydisch, mixolydisch, ionisch, äolisch, lokrisch. Einige Tongeschlechter haben sich ein Überleben in der Nische der evangelischen und ökumenischen Gesangbücher gesichert. Bach (1685 - 1750) wusste noch in dorisch zu komponieren, selbst Beethoven (1770 - 1827) ließ sich zu einem Streichquartett in lydischer Tonart verlocken (Opus 132, 3. Satz, F-Dur mit h statt b).

Neue und fremde Systeme wecken Ablehnung, nicht selten sogar Angst. Im 20. Jahrhundert wollte Arnold Schönberg (1874 - 1951) die Konzertbesucher aus der Gefangenschaft von Dur und Moll befreien und in das gelobte Land der zwölf Töne führen. Der Erfolg der "Dodekafonie" hält sich bis heute in Grenzen. Noch trauriger ging die Revolution einiger Instrumentenbauer aus, die Klaviere mit Viertelton-Intervallen konstruierten - Ladenhüter der Musikgeschichte. Pythagoras bleibt Formgeber, aber auch Diktator unseres Hörempfindens.
Nur in einem Punkt hinkt das Lehrgebäude des Pythagoras. Alle Schüler, die vom Satz des Pythagoras gequält werden, sollten ihren Lehrer einmal nach dem "Komma des Pythagoras" ausfragen. Die wenigsten Studienräte werden ohne Stammeln das Phänomen erklären können. Das Problem ist faszinierend schön: Die Musik des Pythagoras ist das Ebenbild des Sonnensystems - man bestätigt sich gegenseitig. Die Perfektion des Lehrgebäudes funktioniert sogar bis in die kleinste Unebenheit. Beispielsweise lässt sich das Jahr nur knirschend in 365 Tage unterteilen - alle vier Jahre muss dem Februar ein Schalttag hinzugefügt werden.
Faszinierende Gleichung im Musiksystem: Auch hier wird nachkorrigiert - baut man zwölf pythagoreische Quinten auf und vergleicht sie mit dem Ton, den rein rechnerisch auch sieben Oktaven erreichen müssten, so entdeckt man eine Differenz - eben das "pythagoreische Komma". Für die ganz peniblen Mathematiker unter uns: Sieben Oktaven entsprechen einem Frequenzverhältnis von 1:128 - zwölf Quinten dagegen einem Verhältnis von 1:129,746337890625. Eine Winzigkeit, die jedoch nachfolgende Musikergeneration an den Rand der kompositorischen Freiheit trieb. Denn gerade bei fest gestimmten Tasteninstrumenten mussten harmonische Fantastereien unterbleiben; die winzige Differenz konnte sich in entfernten Tonarten zu reibenden Misstönen aufschaukeln. Weshalb 2200 Jahre nach Pythagoras verschiedene Musiker an einer neuen Form der Tonleiter bastelten. Ebenfalls ein Rechenspiel. Andreas Werckmeister verteilte um 1700 die zarten Unregelmäßigkeiten des pythagoreischen Kommas auf alle Halbtöne - die "gleichschwebende Temperatur" war geboren. Ein kleiner Schritt für einen Instrumentenbauer, ein großer Schritt für die Musikgeschichte - seit Werckmeister klingt kein Instrument mehr "rein" nach Pythagoras. Das berühmte "Das Wohltemperirte Clavier" von Johann Sebastian Bach ist eine direkte Antwort auf die neuen Möglichkeiten - ein Universum an Präludien und Fugen, das bis in entlegene Tonarten vorstößt. Sozusagen das Raumschiff Enterprise aller Klavierliteratur.
Die meisten Menschen folgen den Spielregeln von Dur und Moll? Von wegen: Das Volk der Chinesen kann mit "unserer" Musik nur wenig anfangen. Im Reich der Mitte tönt es nach den beherrschenden Vorgaben der "Pentatonik". Statt sieben Töne kennt das Ton-"Alphabet" in Ostasien nur fünf. In der arabischen Musik wird die Oktave in 24 gleich große Intervalle unterteilt. Der Dreiviertelton wird von Musikwissenschaftlern als Kernmerkmal ausgemacht. Für westliche Ohren schwer greifbar. Die klassische indische Musik beeindruckt mit der Aura des Kleinen, Feinen. Im Kern ist es nur einem Instrument erlaubt, die Melodiestimme zu spielen. Ein weiteres Harmonieinstrument wird mit Borduntönen beauftragt - unveränderliche Dauertöne. Dazu gesellen sich ein bis zwei Rhythmusmusiker mit Schlaginstrumenten. Der Tonumfang innerhalb einer Oktave kennt 66 mikrotonale Abstufungen, in der Praxis werden 22 Schritte angewandt.
Abermals: Hören ist kulturelle Versklavung. In der westlichen Kultur verdanken wir die Basis dem Gedankenwerk von Pythagoras. Eine faszinierende Vorstellung: Beethoven, Bach, die Beatles und James Last haben nach den gleichen Spielregeln komponiert, die ein griechischer Philosoph ausformulierte, als er eine Holzkiste mit einem getrockneten Ziegendarm traktierte.
DIE KLASSISCHEN GRENZBRECHER
MOZART Die Entführung aus dem Serail

Diese Oper galt im Wien des Jahres 1782 nicht nur als schick, sondern als geradezu revolutionär. Mozart führt die Zuhörer in einen Harem(!) und forscht der Musiksprache der Türken nach - inklusive eines Chors der Janitscharen, der Elitesoldaten des türkischen Reiches.
Topeinspielung:
Edita Gruberova, Gösta Winbergh - Sir Georg Solti (Decca)
VERDI - Aida

Giuseppe Verdi forschte ernsthaft: Wie wird die Musik im alten Ägypten geklungen haben? Er fand herrlich flirrende, fremdartig schöne Töne. Sein berühmtester Einfall wird heute bei jedem Fußballspiel gebraucht, missbraucht: Der Triumphmarsch tönt aus einer eigens entwickel
ten Fanfarentrompete - übrigens entworfen von Adolphe Sax, dem Erfinder des Saxofons.
Topeinspielung:
Montserrat Caballe?, Placido Domingo Riccardo Muti (EMI)
MAHLER - Das Lied von der Erde

Eine Musik zwischen Rausch und Trauer - mit starken Anklängen an das, was westliche Ohren mit chinesisch assoziieren. Gustav Mahler vertonte sechs Gedichte von altchinesischen Poeten. Große Symphonik, hochemotional, faszinierend instrumentiert und ein Klangfest an guten Lautsprechern.
Topeinspielung:
Fritz Wunderlich, Christa Ludwig Otto Klemperer (EMI)
